Heinrich VI. VON HOHENSTAUFFEN
Characteristics
| Type | Value | Date | Place | Sources |
|---|---|---|---|---|
| name | Heinrich VI. VON HOHENSTAUFFEN |
|
||
| occupation | Kaiser (HRR) |
|
Events
| Type | Date | Place | Sources |
|---|---|---|---|
| death | 28. September 1197 | Messina, Sicilia, ITA
Find persons in this place |
|
| birth | November 1165 | Nimwegen, NL
Find persons in this place |
|
| marriage | 27. January 1186 | Mailand, ITA
Find persons in this place |
??spouses-and-children_en_US??
| Marriage | ??spouse_en_US?? | Children |
|---|---|---|
|
27. January 1186
Mailand, ITA |
Konstanze VON SIZILLIEN |
|
Notes for this person
Heinrich VI. aus dem Geschlecht der Staufer (* November 1165 in Nimwegen; † 28. September 1197 in Messina) wurde 1169 zum römisch-deutschen König gewählt und wurde 1191 zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt. Von 1194 bis zu seinem Tod war er zugleich König von Sizilien.
Heinrich war der zweite Sohn von Insgesamt elf Kindern aus der Verbindung Friedrich Barbarossas mit Beatrix von Burgund. Er heiratete 1186 Konstanze, die als Tochter des Normannenkönigs Roger II. von Sizilien Tante und Erbin des Normannenkönigs Wilhelm II. war. In den letzten Lebensjahren seines Vaters wirkte Heinrich zunehmend eigenständig. Nach dem Tod seines Vaters war er in Konflikte mit dem Welfen Heinrich dem Löwen verwickelt. Erst 1194 gelang ein endgültiger Ausgleich mit den Welfen. In Sizilien wurde Nach dem Tod Wilhelms II. unter Missachtung von Heinrichs Thronansprüchen Tankred von Lecce zum König erhoben. Der Versuch der Eroberung Siziliens auf einem Italienzug im Jahr 1191 scheiterte vor Neapel.
Einer Fürstenverschwörung, die ihren Anlass in den Streitigkeiten um die Besetzung des Lütticher Bischofsstuhls gefunden hatte, konnte Heinrich erfolgreich mit der Gefangennahme des englischen Königs Richard Löwenherz begegnen. Gestützt auf eine immense Lösegeldzahlung und die Leistung des Lehnseids durch Richard glückte Heinrich im Jahr 1194 die Eroberung Siziliens. In den Jahren 1195 und 1196 versuchte Heinrich, das Reich in eine Erbmonarchie umzuwandeln. Er scheiterte jedoch am Widerstand der Reichsfürsten. Auch die endgültige Vereinigung Siziliens mit dem Reich konnte Heinrich wegen der ablehnenden Haltung der Kurie nicht durchsetzen. Heinrich starb während der Vorbereitungen zu einem Kreuzzug, dessen Ziel in Verbindung mit der EroberungJerusalems womöglich auch die Eroberung des byzantinischen Reichs war.[1]
In der Forschung wird Heinrich als fähiger und auch erfolgreicher Herrscher gesehen, aber auch als skrupelloser Machtpolitiker. Letzten Endes sei er nur an seinem frühen Tod gescheitert
Heinrich wurde Im Herbst (vermutlich Oktober oder November) des Jahres 1165 in der Pfalz Nimwegen geboren. Seine Eltern waren Kaiser Friedrich I. und Beatrix von Burgund.
Zu Pfingsten 1169 ließ Friedrich I. Heinrich auf dem Hoftag in Bamberg durch einen Wahlakt zum römischen König bestimmen. Friedrichs Grund für das Betreiben der Wahl war wohl die Absicherung der Nachfolge. Darüber hinaus scheinen von Fürstlicher Seite keine Bedingungen für die Wahl gestellt worden zu sein. Allenfalls riefen die Verhandlungen mit der Kurie Hoffnungen auf die Beendigung des seit der doppelten Papstwahl 1160 bestehenden Schismas hervor. Friedrich erkannte Papst Alexander III. nicht an, während Heinrich dies später tun sollte, um als Thronerbe wieder in Frieden mit dem Papst regieren zu können. Zudem scheint sich Friedrich die Erhebung Heinrichs zum Mitkaiser durch papsttreue Bischöfe gewünscht zu haben. Dieses Vorhaben scheiterte aber an den weitreichenden Forderungen des Kaisers.[2] Heinrich wurde einige Zeit nach der Wahl am 15. August 1169 in Aachen zum König gekrönt.
Als erste politische Handlung Heinrichs taucht sein Name im Jahr 1173 als Zeuge in einer Urkunde Auf. In den folgenden vier Jahren begleitete er seinen Vater auf dessen Italienzug. Zu dieser Zeit erhielt Heinrich wohl Unterricht vom Hofkapellan Gottfried von Viterbo.[3] Chronisten berichten, dass Heinrich Lesen und Schreiben konnte und auch die lateinische Sprache beherrscht haben soll. Gottfried berichtet von Einer Bibliothek Heinrichs in der Pfalz Hagenau und dessen Interesse für philosophische Studien. Der König wird auch mit dem Minnesänger „Kaiser Heinrich“ identifiziert, unter dessen Namen die Manessische Liederhandschrift sowie die Weingartner Liederhandschrift jeweils acht Minnesangstrophen überliefern. Eine endgültige Zuordnung dieser Strophen ist aber nicht möglich. [4] In der Umgebung Heinrichs befanden sich auch Dichter wie Friedrich von Hausen, Bligger von Steinach und Bernger von Horheim.
Im Jahr 1178 kehrte Heinrich mit seinem Vater über Burgund nach Deutschland zurück. Ab dieser Zeit sollte er zunehmend eigene politische Verantwortung tragen. Während sein Vater den Bayern- und Sachsenherzog Heinrich den Löwen niederwarf, war Heinrich vornehmlich im Westen des Reichs tätig. So wirkte er im Jahr 1182 als Vermittler in einem Konflikt zwischen dem französischen König und dem Grafen von Flandern.
Auf dem Hoftag in Mainz empfingen Heinrich und sein Bruder am 21. Mai 1184 die Schwertleite. Am 26. Juli desselben Jahres entging Heinrich knapp einem unrühmlichen Ende, als er beim Erfurter Latrinensturz nicht auf dem hölzernen Boden des Versammlungssaales, sondern in einer steinernen Fensternische saß und dadurch nicht mit in die Abtrittgrube stürzte. Heinrich befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Kriegszug nach Polen, um Großherzog Mieszko Hilfe gegen seinen Bruder Kasimir II. zuteil werden zu lassen. Der Feldzug, auf dem es zu keinen großen militärischen Auseinandersetzungen kam, endete kurz darauf mit der Huldigung Kasimirs.
Spätestens 1184 begann Kaiser Friedrich mit Wilhelm II. von Sizilien, einem vormaligen Parteigänger des Papstes, über eine Verheiratung Heinrichs mit Wilhelms Tante Konstanze (* 1154) zu verhandeln. Wilhelm war bis zu diesem Zeitpunkt kinderlos und hatte möglicherweise keine Erben mehr zu erwarten. [5] Im Heiratsvertrag wurde Daher das Erbrecht Konstanzes auf Sizilien betont. Die sizilianischen Adeligen verpflichteten sich zur Anerkennung von Konstanzes und Heinrichs Thronansprüchen. Im Oktober desselben Jahres versuchte Friedrich erneut erfolglos, die Kaiserkrönung seines Sohnes zu erreichen.
Im Jahr 1185 bereitete Heinrich im Westen des Reichs einen Feldzug gegen Frankreich vor, um den Bündnispartner England zu unterstützen. Die Grafen von Hennegau und Flandern nahmen jedoch aus verschiedenen Gründen nicht am Feldzug teil, sodass mit Frankreich Frieden geschlossen wurde.
Bald darauf begab sich Heinrich nach Italien, wo er am 27. Januar 1186 in Mailand mit Konstanze vermählt wurde. Er und die Königin wurden anschließend zu Königen von Italien gekrönt. Zudem trug Heinrich ab diesem Zeitpunkt den Titel Caesar – womöglich in Anlehnung an die antike Herrschaftspraxis und die auch aus dem römischen Recht gespeiste Kaiseridee der Staufer. Die Vergabe des Titels an Heinrich ist wohl auch als Reaktion auf die abgelehnte Kaiserkrönung Heinrichs zu sehen.[6]
Der kaiserliche Angriff auf Cremona führte zu einer Konfrontation mit Papst Urban III. Heinrich zog in die Toskana, wo sein von Markward von Annweiler befehligtes Heer bis zum Friedensschluss im August 1186 den Kirchenstaat verwüstete. Bis Ende 1187 war Heinrich mit den Reichsangelegenheiten in Italien befasst, bevor er nach Deutschland zurückkehrte.
Im März 1188 wohnte er dem Hoftag Jesu Christi in Mainz bei, auf dem der Kaiser seinen Willen zur Durchführung eines Kreuzzugs bekundete. Als Friedrich I. 1189 zum Dritten Kreuzzug aufbrach, übertrug er Heinrich die Regierung des Reiches. Gegen Ende Des Jahres belehnte der König den Grafen Balduin von Hennegau mit der neu geschaffenen Markgrafschaft Namur. In der Fortsetzung der Politik seines Vaters versuchte Heinrich mit Balduin am Niederrhein ein Gegengewicht zu den Kölner Erzbischöfen und den Großen Flanderns zu schaffen.[7] Heinrich vermittelte einen Ausgleich zwischen Balduin und Heinrich von Brabant. Der König trat ebenso in Verhandlungen mit der Kurie über seine Kaiserkrönung. Er sicherte dem Papst die Rückgabe aller von Den Staufernokkupierten kirchlichen Besitzungen zu. Im Juni des folgenden Jahres starb Kaiser Friedrich während des Kreuzzuges im Fluss Saleph.
Bereits im Jahr 1189 kehrte Heinrich der Löwe, entgegen einer früheren Vereinbarung mit dem Kaiser, aus der Verbannung nach Deutschland zurück. Gestützt durch Erzbischof Hartwig von Bremen bekriegte er seine sächsischen Gegner. Im November 1189 zog König Heinrich gegen Heinrich den Löwen nach Sachsen. Die späte Jahreszeit zwang jedoch zum Abbruch des Feldzugs. Heinrich erfuhr zudem, dass in Sizilien Wilhelm II. verstorben war. Aufgrund von Unruhen und der Fürsprache des sizilianischen Vizekanzlers Matheus von Salerno wurde Tankred von Lecce von Einer Mehrheit der Barone zum König erhoben. Hierdurch wurde Heinrichs und Konstanzes Erbrecht außer Acht gelassen. Nach seiner Krönung nahm Tankred Verbindung zur Kurie auf. Tankreds Krönung soll mitdem Wohlwollen des Papstes stattgefunden haben.[8] In den nun ausbrechenden Feindseligkeiten zwischen den Anhängern Tankreds und den stauferfreundlichen Kräften in Apulien unter Führung des Grafen Roger von Andria sandte Heinrich seinen Marschall Heinrich Testa zur Unterstützung Rogers nach Italien.
Im folgenden Jahr erlitt Heinrich der Löwe militärische Rückschläge durch sächsische Adlige. Mitte Juli kam in Fulda ein Friedensschluss zustande: Der Löwe erhielt die Hälfte der Reichseinkünfte in Lübeck, dafür musste er die Befestigungen Lüneburgs und Braunschweigs schleifen sowie seinen Sohn Heinrich von Braunschweig mit dem Heer des Königs nach Italien ziehen lassen.
In Augsburg ließ Heinrich seinen Italienzug vorbereiten. Hier erfuhr er wohl auch vom Tod seines Vaters und Bruders auf dem Kreuzzug. Während das Heer des Königs nach Italien marschierte,reiste Heinrich nach Thüringen. Landgraf Ludwig III. war im Oktober auf dem Kreuzzug verstorben und sein Bruder Hermann verlangte die Belehnung mit der Landgrafschaft. Heinrich dachte jedoch zunächst daran, Thüringen einzubehalten, gab sein Vorhaben aber nach Zugeständnissen Hermanns auf.[9] Zu Beginn des folgenden Jahres folgte er seinem Heer nach Italien. Dort musste es Heinrichs Ziel sein, neben der Krönung zum Kaiser auch die Eroberung des Königreichs Sizilien zu erreichen. [10]
Im Januar 1191 verhandelte Heinrich VI. in Lodi mit Eleonore von Aquitanien, der Witwe Heinrichs II. von England. Eleonore versuchte die seit 1169 bestehende Verlobung zwischen ihrem SohnRichard Löwenherz und einer Halbschwester Philipp Augusts von Frankreich aufzulösen. Heinrich VI. war ebenfalls am Ende Des Verlöbnisses interessiert, weil Richard sich als Unterstützer Tankreds in Messina aufhielt. Er rechnete damit, dass sich das Verhältnis zwischen England und Frankreich nach dem Lösen der Verlobung verschlechtern würde Und Richard zum Rückzug aus Messina gezwungen worden wäre. Damit hätte er Tankred isoliert. Im Gegenzug sicherte er Eleonore zu, dass er sich nicht in die Auseinandersetzungen des mit ihm verbündeten französischen Königs mit England einschalten würde. Kurz darauf reiste sie nach Rom weiter und erreichte dort die Auflösung der Ehe von Heinrichs VI. Bruder Konrad von Rothenburg mit Berenguela von Kastilien. Mit diesem Zug Eleonores hatten die Staufer ihre Verbindung auf die Iberische Halbinsel verloren und waren so weit isoliert, dass ihnen Frankreich als einziger Verbündeter blieb, dessen Ausgleichsversuche mit England Eleonore ebenfalls vereitelt hatte.[11]
In der Lombardei bemühte sich Heinrich um Bündnispartner unter den Städten Oberitaliens, wobei er eine Bevorzugung Mailands vor anderen Städten zu vermeiden suchte. Heinrich verhandelte außerdem mit Pisa und Genua über Flottenhilfe gegen Sizilien. Im April begannen Verhandlungen mit Papst Coelestin III. über die Kaiserkrönung. Heinrich musste die verbündete Stadt Tusculum an die Römer ausliefern, welche die Rivalin vollständig niederrissen. Die Übergabe des Verbündeten Tusculum wurde Von Den Zeitgenossen als ehrloses Verhalten angesehen.[12] Am Ostermontag,dem 15. April, wurde Heinrich von Coelestin III. zum Kaiser gekrönt. Hierbei soll der Kaiser vom Papst die Investur mit dem Imperium verlangt haben.[13]
Nach der Kaiserkrönung zog das Heer Heinrichs nach Apulien, wo im Jahr zuvor der staufertreue Graf von Andria besiegt worden war. Im Mai begann man mit der Belagerung Neapels. Da es Hochsommer war, brach unter den Belagerern bald eine Seuche aus, an der ein Großteil des Heeres sowie viele hohe Persönlichkeiten starben. Auch der Kaiser erkrankte daran. Da zudem die pisanische und bald auch die Genueser Flotte vom sizilianischen Admiral Margaritus vertrieben wurden, brach man die Belagerung Ende August ab. Einen weiteren Schicksalsschlag erfuhr Heinrich, als Konstanze, die sich während der Kämpfe vor Neapel in Salerno aufgehalten hatte, gefangen gesetzt und nach Palermo gebracht wurde. In Oberitalien nahm der Kaiser noch bis Ende Des Jahres die Reichsangelegenheiten wahr und schloss ein Bündnis mit Philipp II. von Frankreich gegen Richard Löwenherz. Tankred nutzte den Rückzug Heinrichs, um sich auch in den Festlandsgebieten desNormannenreiches durchzusetzen.
In Deutschland hatte sich Heinrich der Löwe keineswegs bemüht, die im Frieden von Fulda getroffenen Vereinbarungen in die Tat umzusetzen. Vielmehr begannen erneut kriegerische Auseinandersetzungen zwischen ihm und seinen sächsischen Gegnern (Askanier, Schauenburger). Heinrichs Sohn Heinrich von Braunschweig hatte vor Neapel das Heer des Kaisers verlassen.[14] Dieser ächtete ihn nun an Pfingsten 1192 auf Hoftag zu Worms. Heinrich scheint jedoch eher an einer friedlichen Lösung des Konflikts interessiert gewesen zu sein, da er die antiwelfischen Kräfte in Sachsen nicht unterstützte.[15] Da auch Erzbischof Wichmann von Magdeburg, der führende Anhänger der Staufer in Norddeutschland, starb, schlossen sie einen Waffenstillstand mit Heinrich dem Löwen, welcher auf Bitte des Kaisers verlängert wurde.
Kaiser Heinrich erbte durch den Tod Welfs VI. dessen Besitzungen in Schwaben, womit er die staufische Hausmacht in diesem Gebiet stärken konnte. Im September 1192 begab sich Heinrich nachLüttich, um die Stellung des dort von Ihm als Bischof Eingesetzten Lothar von Hochstaden zu sichern. Der Kaiser hatte Lothar im Frühjahr auf dem Hoftag zu Worms gegen den Kandidaten Heinrichs I. von Brabant, dessen Bruder Albert von Löwen, durchgesetzt. Albert hatte daraufhin mit päpstlicher Bestätigung die Bischofsweihe in Reims empfangen und schickte sich nun an, den Lütticher Bischofsstuhl mit Unterstützung seines Bruders für sich zu gewinnen. Der Kaiser ging militärisch gegen Lothars Opponenten vor und konnte Heinrich von Brabant schnell zu einem Friedensschluss zwingen.
Im Oktober widmete sich Heinrich der Absetzung des Bremer Bischofs Hartwig,
eines Parteigängers Heinrich des Löwen. Im Osten des Reichs vermittelte er einen Frieden zwischen dem Landgrafen Hermann von Thüringen und dem Markgrafen Albrecht von Meißen. Zu dieser Zeit wurde Albert von Löwen von Deutschen Rittern erschlagen. Heinrich von Brabant lastete den Mord an seinem Bruder dem Kaiser an. Diese Vorkommnisse schufen ein neues Konfliktpotenzial mitdem Adel im Westen Deutschlands. Mit der von Ihm propagierten Nachfolge hatte Heinrich VI. versucht, den kaiserskeptischen Adel in dieser Region unter seine Kontrolle zu bringen.[16] Gerade Dieser Versuch führte aber zu neuem Widerstand unter der Führung des Kölner Erzbischofs Bruno. Der Opposition schlossen sich die Herzöge von Brabant und Limburg an. Es soll sogar die Erhebung des Brabanters zum Gegenkönig in Betracht gezogen worden sein.[17] Außerdem bestanden Kontakte zum Mainzer Erzbischof Konrad, den Thüringer Landgrafen, dem Meißner Markgrafen, dem Herzog von Böhmen, den Königshäusern von Dänemark und England und dem Welfen Heinrich dem Löwen. Die Kurie war wegen der Besetzung des Lütticher Bischofsstuhls mit Lothar von Hochstaden verärgert und die Zähringer stellten am Oberrhein eine Gefahr für den staufischen Herrschaftsbereich dar.
In die Zeit der Bedrohung von Heinrichs Herrschaft durch die Fürstenopposition fällt die Gefangennahme Richards I. „Löwenherz“ auf der Rückreise vom Kreuzzug. Richard war in Aquileja schiffbrüchig geworden und ging in der Grafschaft Görz an Land. Im Dezember 1192 ließ ihn der Babenberger Leopold V. von Österreich, gefangennehmen und zunächst auf der Burg Dürnstein festgehalten. Die Gefangennahme hatte Heinrich zuvor in Mailand mit dem französischen König Philipp August verabredet und war seine Reaktion auf das militärische Bündnis, das Richard mit Tankred von Lecce im Herbst 1190 abgeschlossen hatte.[18] Kreuzzugsheimkehrer standen unter besonderem Schutz der Kirche. Deshalb ging sie auch mit der Exkommunikation gegen Leopold vor. Der Gefangene wurde Im März 1193 in Speyer zunächst an Heinrich selbst übergeben, der ihn unter anderem auch auf Burg Trifels in der Pfalz inhaftieren ließ.
Im Frühjahr 1193 stellte der Kaiser eine Lösegeldforderung an Richard. Dieser sollte 100.000 Mark, die zur Hälfte an Leopold gehen sollten zahlen. Offiziell wurde Das Geld als Mitgift fürRichards Nichte, die einen der Söhne Leopolds heiraten sollte, deklariert. Weiterhin sollte Richard mit einem von Ihm gestellten Heer an einem Feldzug gegen seinen einstigen Verbündeten Tankred teilnehmen. Für seine Freilassung hatte Richard Geiseln zu stellen.
Die Inhaftierung ihres Verbündeten Richard bedeutete eine schwere Niederlage für die Fürstenopposition. Im Juni 1193 musste Richard den Fürsten die Aufnahme von Verhandlungen mit dem Kaiser nahelegen. Der Kaiser distanzierte sich vom Mord an Albert von Löwen und ließ die Mörder verbannen. Die Herzöge von Brabant und Limburg sollten fortan in den Bischofswahlen in Lüttich ihre Kandidaten unterstützen dürfen. Bruno von Köln wurde eine Garantie seiner Herrschaftsrechte ausgestattet. Der ebenfalls zur Fürstenopposition gehörende Herzog von Böhmen wurde Durch einen Angriff des Bischofs von Prag ausgeschaltet.
Obwohl sowohl Philipp August als auch Richards Bruder Johann Ohneland, der die Regentschaft in England innehatte, die Zahlung eines Lösegeldes anboten, wenn der König noch ein Jahr längerin Gefangenschaft bleiben würde, einigte sich Heinrich im Juni 1193 mit Richard. Richard, dessen Mutter Eleonore die Freilassung ihres Sohnes unterstützte, verpflichtete sich, England vomKaiser als Lehen zu nehmen, und neben den 100.000 Mark einen Jahreszins von 5.000 Pfund zu zahlen. Damit erkannte Richard für sein Königreich England die Oberhoheit des Kaisers an. von Philipp und Johann forderte Heinrich unter Androhung militärischer Gewalt die Rückgabe aller Besitzungen, die Richard während seiner Gefangenschaft abgenommen worden waren. Diese Lösung hatte für Heinrich den Vorteil, dass er Richard als Vasallen gewonnen hatte, also nicht mehr allein auf Frankreich angewiesen war, gleichzeitig aber Richard als unabhängigen englischen König erhielt, der weiter gegen Frankreich kämpfte, wodurch auch Philipp August auf Heinrich als Verbündeten angewiesen war. Der Kaiser manövrierte sich damit geschickt in eine Vermittlerpositionzwischen England und Frankreich.[19]
Im Februar 1194 wurde Der Konflikt mit den Welfen durch die Eheschließung von Heinrichs des Löwen gleichnamigem Sohn mit Agnes von Staufen, der Erbin des rheinischen Pfalzgrafen Konrad von Staufen, endgültig beigelegt. Dieses Ereignis bedeutete einen großen Erfolg der Welfen im westdeutschen Raum, da sie den territorialen Gewinn schnell fixierten, indem sie die Pfalzgrafenwürde Von Einem kaiserlichen Amt in eine Territorialherrschaft umwandelten. Im März schloss Heinrich VI. dann auch offiziell Frieden mit Heinrich dem Löwen.
Während Heinrich in Deutschland die Fürstenopposition bekämpfen musste, setzten sich die Auseinandersetzungen in Italien weiter fort. Nach Heinrichs Niederlage vor Neapel eroberte Tankreds Schwager, Graf Richard von Acerra, den Großteil Apuliens zurück. Im Frühjahr 1192 führten Verhandlungen mit dem Papst zur Freilassung von Konstanze. Eine Anerkennung von Tankreds Königtum lehnte Heinrich aber weiterhin ab. Tankred gelang es allerdings, unter der Bedingung, dass er die Lehnsherrschaft des Papstes über Sizilien anerkannte, von Coelistin III. eine Bestätigung seines Königtums zu erhalten.[20] Im Sommer 1192 schloss Heinrich ein Bündnis mit wichtigen oberitalienischen Städten und dem Markgrafen von Montferrat, um den Frieden in der Lombardei für den geplanten Feldzug gegen Sizilien aufrecht zu erhalten. In Tuszien wurde Konrad von Lützelhardt die Reichsverwaltung übertragen.
Im Februar 1194 starb König Tankred. Sein minderjähriger Sohn Wilhelm III. wurde Als Nachfolger eingesetzt. Die Regentschaft führte seine Mutter Sibylle. Der Kaiser begann im Mai 1194, finanziert mit dem Lösegeld für Richard Löwenherz, einen neuen Feldzug gegen Sizilien. In der Lombardei feierte er das Pfingstfest in Mailand und versicherte sich in den nächsten Monaten derFlottenhilfe Genuas und Pisas. Im August öffnete Neapel dem Kaiser kampflos die Tore. Salerno, das im Jahr 1191 die Kaiserin an Tankred ausgeliefert hatte, wurde Im September 1194 vollständig niedergebrannt. Am 20. November 1194 zog Heinrich in Palermo ein und wurde Im dortigen Dom zu Weihnachten (25. Dezember 1194) zum König von Sizilien gekrönt. Am Tag nach der Krönung zum König von Sizilien brachte Konstanze in Jesi bei Ancona das einzige Kind Heinrichs VI. zur Welt, den späteren Kaiser Friedrich II.
Wenige Zeit darauf ließ der Kaiser führende Normannische Adelige unter dem Vorwand einer Verschwörung gegen ihn inhaftieren. Der normannische Königsschatz wurde Nach Deutschland gebracht,ebenso die Königsfamilie, die beschuldigt wurde, Mitwisser der Verschwörung gewesen zu sein.
Auf einem Reichstag in Bari im März 1195 versuchte Heinrich VI., die Erfolge des Vorjahres politisch umzusetzen: Heinrichs Frau Konstanze sollte zur Regentin Siziliens werden, allerdings neben dem kaisertreuen Statthalter Konrad von Urslingen, einem Edelfreien. Kanzler von Sizilien wurde Walter von Palearia. Auch in andere normannische Verwaltungsämter wurden Ministeriale eingesetzt. Markward von Annweiler wurde Für seine Verdienste zum Herzog von Ravenna, Grafen von Romagna und Markgrafen von Ancona erhoben. Heinrichs Bruder Philipp wurde Das Herzogtum Toskana und in den Mathildischen Gütern übertragen. Dieses Vorgehen sollte Sizilien mit Oberitalien verbinden und das Normannenreich unlösbar in den Reichsverbund einschließen. Darüber hinausscheint es Heinrichs Absicht gewesen zu sein, das reiche und mit modernen Verwaltungsstrukturen versehene Sizilien als ein Zentrum des Reiches und der staufischen Hausmacht aufzubauen.
Auf dem Hoftag von Bari gelobte Heinrich der Kurie seinen Wunsch, einen Kreuzzug durchzuführen.[21] Damit verfolgte er mehrere Ziele. So sollte der Kreuzzug Papst Coelestin III. dazu bewegen, der Vereinigung Siziliens mit dem Reich (unio regni ad imperium) zuzustimmen und die von Ihm über Sizilien beanspruchte Lehnshoheit aufzugeben. Heinrich versprach der Kurie 1.500 Ritter und dieselbe Anzahl an Fußsoldaten für ein Jahr dem Kreuzzugsunternehmen zukommen zu lassen. Weitere Gespräche mit Kardinälen in Ascoli brachten jedoch keinen Fortschritt für die kaiserliche Seite.
Die zentrale ideengeschichtliche Rolle haben wohl eschatologische Vorstellungen gespielt. Dieser Auffassung zufolge verstand Heinrich sich oder zumindest einen zu erwartenden Nachfolger aus seinem Haus als den Friedenskaiser, den letzten Kaiser vor dem Jüngsten Gericht. Vorstellungen seiner Zeit zufolge sollte dieser Endkaiser den Osten und Westen vereinigen, die Juden zumChristentum bekehren und die Heiden im Heiligen Land besiegen. Mit der Eroberung Jerusalems und der Niederlegung von Krone und Zepter auf dem Hügel Golgota würde Der Endkaiser danach das Jüngste Gericht einleiten. Als Ziel Heinrichs wird dementsprechend nicht der Erwerb möglichst vieler Territorien angesehen, sondern die mit der Inbesitznahme Jerusalems erfolgende Erhöhungder Würde Des Kaisergeschlechts der Staufer.[22]
In der Forschung ist umstritten, ob sich Heinrichs Expansionsabsichten sich auch gegen das Byzantinische Reich richteten. 1194 hatten Gesandte des byzantinischen Vasallen Leo II. von Kleinarmenien vom Kaiser die Königskrone für Leo und die Belehnung mit einem Teil Syriens erlangt. 1196 empfing auch Amalrich von Zypern sein Reich als Lehen vom Kaiser.
Im Frühjahr 1195 forderten Gesandte des Kaisers in Byzanz einen Streifen von Durazzo bis Thessaloniki, der früher Wilhelm II. gehört hatte. Dies wird von Claudia Naumann als Wiederaufnahme der normannischen Politik gegenüber Byzanz gewertet.[23] Bald darauf wurde Isaak II. durch seinen Bruder Alexios III. gestürzt. Ende 1195 forderte eine zweite Gesandtschaft Heinrichs vomneuen byzantinischen Kaiser die Unterstützung des Kreuzzuges durch Flottenhilfe und die jährliche Zahlung von 5.000 Pfund Gold. Bei Nichterfüllung drohte Heinrich mit dem Angriff auf Byzanz. In weiteren Verhandlungen wurde Die Summe auf 1.600 Pfund herabgehandelt.[24] Naumann sieht somit die Angriffsdrohung des Kaisers als Mittel zur Erreichung von Byzantinischer Hilfe zurDurchführung des Kreuzzugs.[25]
Demgegenüber wird der Sturz Isaaks II. durch seinen Bruder Alexios III. als Möglichkeit für Heinrich gewertet, Anspruch auf ganz Byzanz zu erheben. Angeführt wird, dass Heinrichs Bruder Philipp die verwitwete Schwiegertochter Tankreds, eine Tochter Isaaks, heiratete. Dadurch habe Heinrich VI. sich zum Verteidiger der Rechte des gestürzten Kaisers machen können. Mit der Unterstützung der Reiche Zypern und Kleinarmenien hätte Heinrich so das östliche Mittelmeer unter seine Herrschaft bringen können, was womöglich in einer Eroberung des byzantinischen Reichs gegipfelt hätte.[26]
Eine weitere Stütze in der Beherrschung des Mittelmeerraums bildete die Gewinnung der alten normannischen Besitzungen in Nordafrika. Der Kalif von Tripolis und Tunis willigte angesichts der Forderungen Heinrichs und der innermoslemischen Bedrohung durch die Almohaden in Tributzahlungen ein.
Im Sommer des Jahres 1195 kehrte Heinrich nach Deutschland zurück, um Unterstützung für den Kreuzzug zu erhalten die Nachfolge für den Fall seines Todes auf dem Kreuzzug nach seinen Wünschen zu gestalten. Vorerst musste er sich aber mit den Verhältnissen in der Markgrafschaft Meißen befassen. Dort schwelte seit der Zeit seiner Thronbesteigung die Fehde Zwischen den BrüdernAlbrecht und Dietrich. Albrecht bedrohte das der Mark benachbarte Pleißenland, welches im Besitz der Staufer war. Durch den Tod Albrechts im Juli 1195 bot sich für Heinrich die Möglichkeit, die Stellung der Wettiner zu schwächen. Er verweigerte Dietrich die Belehnung mit der Markgrafschaft Meißen und behielt sie ein.[27]
Im Oktober 1195 kam es auf dem Hoftag zu Gelnhausen zur Einigung zwischen dem in sein Erzbistum zurückgekehrten Hartwig von Bremen und dem Kaiser. Gegen Zugeständnisse in territorialer und materieller Hinsicht erhielt Hartwig die Erlaubnis den Bischofsstuhl von Bremen wieder einzunehmen. In Gelnhausen schlossen sich dem Kaiser zahlreiche sächsische und thüringische Adeligeals Begleitung auf dem Kreuzzug an. Im Dezember fand der Kreuzzugsaufruf des Kaisers auf dem Hoftag in Worms große Resonanz. Dort designierte Heinrich seinen Sohn Friedrich zu seinem Nachfolger als deutscher König. Gleichzeitig legte er den Aufbruch zum Kreuzzug auf das nächste Weihnachtsfest. Seinen Sohn Friedrich designierte Heinrich zu seinem Nachfolger als deutscher König. Heinrich versprach den Fürsten im Fall der Wahl seines Sohnes die öffentliche Kreuznahme. Die Wahl des jungen Friedrich scheiterte aber am Widerstand des Könlner Erzbischofs Adolf.[28]
Der Wunsch der Fürsten war die Möglichkeit einer Vererbung ihrer Lehen auch an illegitime Kinder und in weiblicher Linie.[29] Daraufhin scheint um die Jahreswende 1195/96 in Heinrichs Umgebung, möglicherweise in der Pfalz Hagenau, der sogenannte Erbreichsplan entwickelt worden zu sein. Es wird vermutet, dass der päpstliche Legat während der Gespräche anwesend war.[30] Im März 1196 schlug Heinrich den Fürsten in Mainz vor, das Reich zu einem Erbreich zu machen. Auf Drohungen Heinrichs stimmten die Fürsten dem Erbreichsplan zu.[31] Ende März sollten die Verhandlungen auf einem Hoftag in Würzburg zu Ende Geführt werden. Dort soll Heinrich seinen Wunsch erklärt haben, das Sizilien mit dem Reich zu verbinden und die Herrscher dieses Reichs einzigauf dem Erbweg zu bestimmen. Als Gegenleistung sollten die Fürsten ihre Lehen auch in weiblicher Linie vererben dürfen. Die Zustimmung der geistlichen Fürsten sollte durch den Verzicht aufdas Regalienrecht (den Erhalt der Einkünfte einer geistlichen Besitzung während einer Sedisvakanz) gesichert werden. Die Fürsten scheinen dem Vorschlag des Kaisers wie auch der Wahl seines Sohnes zum König ihre Zustimmung gegeben haben.[32] Bei Teilen der Fürsten, insbesondere denen aus dem sächsischen Raum, regte sich aber Unzufriedenheit über den Plan des Kaisers. Adolfvon Köln erschien sogar nicht auf dem Hoftag.
Im Juli 1196 zog Heinrich über Burgund nach Italien. Dort verhandelte er mit Coelestin III. über die Taufe und Königssalbung seines Sohnes durch den Papst, wofür der Kaiser öffentlich dasKreuz nehmen wollte. Um einen dauerhaften Ausgleich mit der Kurie zu erzielen, machte er dem Papst ein aus seiner Sicht „höchstes Angebot“. Da die Quellen über die Einzelheiten dieses Angebots schweigen, wurden vielfach Vermutungen über seien Inhalt angestellt. Der Historiker Johannes Haller verband das Angebot mit den Geschehnissen während der Kaiserkrönung Heinrichs. Er folgerte, der Kaiser habe dem Papst die Lehnsherrschaft über das Reich angeboten. Die neuere Forschung nimmt an, Heinrich habe der Kurie die wertvollste Pfründe An jeder größeren Bischofskriche im Reich als Besitz zuweisen wollen.[33] Der Papst lehnte Heinrichs Vorschläge jedoch ab, da eine Salbung Friedrichs durch den Papst auch als Akzeptanz der Herrschaft der Staufer überSizilien hätte gewertet werden können. Dadurch wäre der Kirchenstaat von Den Staufern endgültig eingekreist worden.[34] In Deutschland sammelte sich währenddessen in Thüringen und SachsenWiderstand gegen den Erbreichsplan. Wahrscheinlich wollten die Fürsten den Kaiser durch die Verzögerung der Vorbereitungen zum Kreuzzug zur Wiederaufnahme der Verhandlungen zwingen. Nachdem Heinrich verschiedene Mahnungen an die Fürsten gesandt hatte, nahmen einige auch die Zustimmung zur Wahl Friedrichs zurück. Da der Papst unter diesen Bedingungen weitere Gespräche verweigerte, entließ der Kaiser die Fürsten aus ihren Versprechungen. Daraufhin wählten die Fürsten Friedrich um die Weihnachtszeit 1196 in Frankfurt zum römischen König.
von Mittelitalien aus begab sich Heinrich Ende 1196 nach Capua, wo er den vom Ministerialen Diepold von Schweinspeunt gefangenen Grafen Richard von Acerra grausam hinrichten ließ. Im März1197 betrat er sizilianischen Boden. In Palermo nahm er eine Überprüfung der Privilegien vor, die dem sizilianischen Adel zugestanden worden waren. Im Mai begab er sich zur Vorbereitung seines Kreuzzugs nach Messina. Dort erfuhr er von Einer großangelegten Verschwörung sizilianischer Adeliger, die seine Ermordung und die Machtübernahme in Sizilien planten. Die bei Catania versammelten Aufständischen wurden von Markward von Annweiler und Heinrich von Kalden niedergeworfen. Ihrem Anführer, der sich in Castrogiovanni verschanzt hatte, ließ Heinrich eine glühende Krone auf den Kopf nageln. Papst Coelestin und auch Heinrichs Frau Konstanze wurden der Beteiligung an dem Aufruhr verdächtigt. Letzteres wird von Der Forschung eher kritisch gesehen.[35]
Ende August soll den Kaiser auf der Jagd bei Fiumedinisi ein heftiger Schüttelfrost befallen haben. Erst gegen Ende September schien sich sein Zustand zu verbessern, doch dann verstarb eram 28. September im Alter von 32 Jahren in Messina. Es wird vermutet, dass der Kaiser letzten Endes an Malaria starb, an der er möglicherweise während der Belagerung Neapels 1191 erkranktwar. Es ging allerdings auch das Gerücht um, dass ihn seine Gattin Konstanze habe vergiften lassen.
Konstanze ließ Heinrich vorerst in Messina zu Grabe legen. Seit der Gefangennahme des englischen Königs galt Heinrich als exkommuniziert. Daher versuchte Konstanze, vom Papst eine Freisprechung des Toten vom Bann zu erreichen. Allerdings gewährte dies erst Innozenz III. im Jahr 1198. Wahrscheinlich Anfang Mai 1198 wurde Heinrich in einem Porphyrsarkophag im Dom von Palermobeigesetzt.
In seinem Testament, dessen Inhalt freilich nur durch Innozenz III. überliefert wurde, verfügte er, dass dem Papst Gebiete in Mittelitalien zugestanden werden sollten, damit dieser seinenSohn zum Kaiser kröne. Im Fall, dass Friedrich und Konstanze ohne Nachkommen sterben sollten, sollte das Königreich Sizilien an den Papst fallen.
Nach Heinrichs Tod erfuhr das staufische Reich mehrere Krisen. In Deutschland wählten die staufischen Parteigänger Heinrichs jüngsten Bruder Philipp von Schwaben, die Welfen Otto IV. von Braunschweig, den Sohn Heinrichs des Löwen, zum König. In Rom bestieg 1198 Innozenz III. den Papstthron, der die Weltherrschaft der Staufer durch die Weltherrschaft des Papsttums ersetzen wollte. Im selben Jahr starb Konstanze, die in Sizilien die Regierung für den erst zweijährigen Friedrich übernommen hatte. In ihrem Testament setzte sie Innozenz als Vormund des jungen Friedrich ein. Der Kreuzzug erreichte ohne die Führung Heinrichs nur begrenzte Erfolge.
Die Politik Heinrichs wurde Maßgeblich im Bereich der kaiserlichen Kanzlei und Kapelle verwaltet. Die Namen der Angehörigen von Kapelle und Kanzlei sind allerdings nur in manchen Fällen bekannt, da die deutschen Notare in ihren Urkunden keinen Schreibvermerk (die Angabe des Verfassers einer Urkunde) verwendeten. So lässt sich ihre Zahl nur durch unterschiedliche Schriftbilder bestimmen.
Das Amt des Kanzlers bekleidete unter Heinrich VI. zunächst Diether von Katzenelnbogen. Nach dessen Tod während der Belagerung von Neapel 1191 blieb das Kanzleramt vorerst unbesetzt. Vermutlich wurde Dessen Funktion vom Vertrauten des Kaisers dem Protonotar Heinrich von Utrecht, dem Bischof von Worms, ausgefüllt.[36] Dass Heinrich 1192 Lothar von Hochstaden mit dem Kanzleramt betraute, wird eher als Maßnahme zu dessen zusätzliucher Legitimierung für die Lütticher Bischofswürde Verstanden. 1194 besetzte der Kaiser das Amt des sizilianischen Kanzlers mit dem Protonotar Sigelo, der bereits kurz darauf verstarb. Im folgenden Jahr erhob Heinrich Konrad von Querfurt zum Kanzler, der gleichzeitig auf Betreiben des Kaisers zum Bischof von Hildesheimgewählt wurde.
Im Gegensatz zu der Zeit seines Vaters, lässt sich für Heinrichs Regierung ein Absinken der Bedeutung des Kanzleramts feststellen. Erst durch Konrad von Querfurt erlangte das Amt wieder politische Bedeutung.[37]
Gesandtschaften Heinrichs wurden zumeist von Hochrangigen Geistlichen geleitet. Geistliche Reichsfürsten wie die Erzbischöfe Philipp von Köln oder Konrad von Mainz wirkten in ihrer Politik eher im Sinne des Kaisers. Mit kriegerischen Aufgaben betraute Heinrich Ministeriale wie Markward von Annweiler.
Stützen von Heinrichs Herrschaft unter den Reichsfürsten waren neben den Babenbergern in Österreich in erster Linie seine Familienangehörigen. Insbesondere sein Onkel Konrad seine Brüder Otto und Konrad und Philipp, die beide Nacheinander die Herzogswürde In Schwaben innehatten, waren wichtige Vertreter der kaiserlichen Machtstellung wenn sich Heinrich in Italien aufhielt.
In Italien hatte der Kaiser vergleichsweise wenige einheimische engere Gefolgsleute.
Heinrichs Herrschaft war in beständige Reiseaktivitäten eingebunden (Reisekönigtum). Als Aufenthaltsorte wählte Heinrich, entsprechend dem Herkommen, hierbei vor allem die Reichsbistümer und die Königsgüter. Hierbei überwiegt die Zahl und Dauer der Aufenthalte auf den Königsgütern im Vergleich zu denen auf Gebiet der Reichskirche. Somit wird bereits für Heinrichs Regierungszeit ein Rückgang der reichskirchlichen Servitien (Beherbergung des Königs und seines Gefolges) angenommen.
Heinrich hielt sich vor allem in den Kernlandschaften des Reiches im Mittel- und Oberrheingebiet und im Maingebiet auf. Hingegen hat sich im Vergleich zu der Regierungszeit seines Vaters nur selten in den sächsischen, bayrischen und niederrheinischen Raum bewegt. Dies geschah stets nur aus besonderen Gründen. Die geringe Anzahl von Aufenthalten im schwäbischen Raum wird dadurch erklärt, dass in diesem als staufischem Stammland keine dauerhafte Präsenz des Königs zur Herrschaftssicherung nötig war. Allgemein wird für Heinrichs Regentschaft eine Schwächung der Königsmacht in den Randgebieten des Reiches festgestellt.[38]
Während der Reisen Heinrichs stellte seine Kanzlei Urkunden aus. Die Urkunden empfingen zumeist nur die Herrschaftsträger am jeweiligen Aufenthaltsort des Kaisers. Einzig im Rhein-Main-Gebiet wurden die Urkunden des Herrschers in größerem Maße überregional ausgestellt.
von Den ausgestellten Urkunden sind heute etwas mehr als 500 erhalten. 40 Prozent davon Sind Originale. Zwei Drittel der Urkunden wurden an Empfänger italienischer Herkunft ausgestellt, was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zur Herrschaft seines Vaters darstellt. Der Grund hierfür wird vor allem in dem erweiterten Empfängerkreis durch die Eroberung Siziliens gesehen. Eine Bevorzugung bei der Privilegienvergabe fand im Fall von Staufischen Verbündeten am Niederrhein und in Sachsen statt, wo die Gegenerschaft zu Heinrichs Herrschaft besonders groß war. Imstaufischen Kernland gab es kaum wichtige Privilegienvergaben, da der Kaiser hier darauf bedacht sein musste, seine Herrschaft möglichst nicht zu schwächen. Außerdem bevorzugte Heinrich die Städte des Reichs und den Zisterzienserorden bei der Urkundenausstellung.
Sources
| 1 | http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_VI._(HRR) |
Unique identifier(s)
GEDCOM provides the ability to assign a globally unique identifier to individuals. This allows you to find and link them across family trees. This is also the safest way to create a permanent link that will survive any updates to the file.
files
| Title | Ackermann-Ahnen |
| Description | Familienforschung Europa |
| Id | 47324 |
| Upload date | 2024-11-19 22:42:16.0 |
| Submitter |
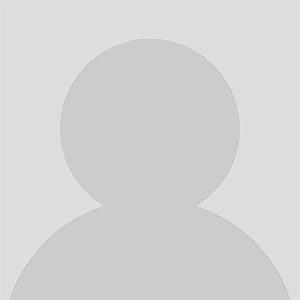 Thomas Wolfgang Ackermann
visit the user's profile page
Thomas Wolfgang Ackermann
visit the user's profile page
|
| ackermann.fuldatal@googlemail.com | |
| ??show-persons-in-database_en_US?? | |
Download
The submitter does not allow this file to be downloaded.