Sebastian RAUCH
Characteristics
| Type | Value | Date | Place | Sources |
|---|---|---|---|---|
| name | Sebastian RAUCH |
|
||
| title | Müllermstr. |
|
Events
| Type | Date | Place | Sources |
|---|---|---|---|
| death | 7 FEB 1732/33 | Hals Tachau
Find persons in this place |
|
| burial | 9 FEB 1732/33 | Hals Tachau
Find persons in this place |
|
| birth | 9. May 1684 | Hals Tachau
Find persons in this place |
|
| marriage | 9. November 1706 | Tachau
Find persons in this place |
Parents
| Johann RAUCH | Anna Dorothea INGELING |
??spouses-and-children_en_US??
| Marriage | ??spouse_en_US?? | Children |
|---|---|---|
|
9. November 1706
Tachau |
Marie WAMESER |
|
Notes for this person
Sebastian Rauch Jg. 1707 Chip 4 1707 / 16 Stammbaum Tafel 27 - Genealogie Familie Reichel www.genealogie-reichel.de/tafel_27.htm 06.09.2015 - (324). Andreas Sauerstein. Müllermeister. ~ SchönbrunnerMühle 4.7.1751. Galtenhof 25.11.1828. (648). Johann Sauerstein. Müller. Schönbrunn 28.12.1787. ?? Tachau11.2.1749. >>> (649). Dorothea Rauch. ~ Hals 3.6.1724. Schönbrunn 6.5.1790. >>> (325). Magdalena Pfeil. Tachau 29.2.1808. Es fehlt: 1700 Sterbereg. Tachau 07.02.1733 Sebastian Rauch, Ex Hals, Molitor, obüt, begraben den 09. Februar,Sepulti 48 annorum, - geboren 1684 Capellanum Georg Knirade Chip 310 Einzugsgebiet Geographisch gesehen, liegt der Ursprung des Baches an einer europäischenWasserscheide, welche ihre Wässer in die Nordsee und zum Schwarzen Meerableitet. Die Trennlinie dieser verläuft vom Ahornberg, Bayern (3 kmnordöstlich von Hermannsreuth) zur Höhe 801, etwa 1 km südlich vonHermannsreuth (eigenartiger weise hat diese Höhe auf keiner Landkarteeinen eigenen Namen aufzuweisen), von dort zur total zerstörten OrtschaftBaderwinkel (Vetrov), weiter zu den ebenfalls zerstörten Schanzhäusern ander Staatsgrenze, zum Schmuckerberg (Bayern) und zum Bärnauerberg(Böhmen). Letzterer bildet einen Eckpfeiler der Wasserscheide. Südlichdavon befindet sich der Entenbühl (Bayern), 902 m Sh und der GroßeRabenberg (Böhmen), 874 m Sh, der höchste Berg des ehemaligen BezirkesTachau. Die Trennlinie verläuft weiter zum Bletznes , Buchen-, Glas-und Höllberg bei Schönwald (Lesna) in Böhmen. Folgende Gewässer entspringen im Bereich der Wasserscheide Elbe und Donau. 1 Am Ahornberg, 792 m Sh Der Reichenbach (fließt zur Elbe) Der Schwarzenbach (fließt zur Donau) 2 Die Höhe 801 Der Heiligen und der Steinbach (fließen zur Donau) 3 Der Schmuckerberg, 802 m Sh Der Paulusbrunnerbach (fließt zur Elbe) 4 Der Bärnauerberg, 815 m Sh Die Waldnaab (fließt zur Donau) Der Zottbach (fließt zur Donau) 5 Der Höllberg, 715 m Sh Der Schönwalderbach (fließt zur Elbe) Der Katharienenbach (fließt zur Donau) Die Tschechen nennen heute das Gebiet des nördlichen Böhmerwaldes CeskyLes, d.h. auf Deutsch Böhmischer Wald, nicht Böhmerwald. Dieser wirdSumava genannt. Der Reichenbach Inder Senke, nordwestlich von Hermannsreuth , liegen die acht Quellen(teilweise mit Bach bezeichnet), die nach ihren Zusammenflüssen den NamenReichenbach (unterhalb der Unteren Kellermühle) annehmen. Die meistenWässer entspringen südlich der Ortschaft Asch im Landkreis Tirschenreuth(Bayern), nämlich bei der aufgelassenen Öde Aschersreuth in 710 m Sh. Dieabfließenden Wässer berühren zunächst den Mühlweiher und 2 andere Teichebei der Oberen Kellermühle und fließen zur Unteren Kellermühle weiter.Von dort unterquert er eine Brücke der Straße nach Hermannsreuth undläuft zur Staatsgrenze weiter. Das Wasser fließt nunmehr in östlicherRichtung entlang eines schmalen Streifens nasser Uferwiesen (Lohe undGewächs) weiter und nimmt den aus nördlicher Richtung kommendenSteinbach auf. Am Grenzstein Nr. 33 (in 648 m Sh) vorbei zum GrenzsteinNr. 32 (in 617 m Sh) fließend verläßt der Bach bei den Reichenwiesen dasLand Bayern. Nunmehr bildet dieser auch die Grenze zwischen demehemaligen Ringelberger Revier (Gemeinde Ringelberg) und der GemeindeGaltenhof( Das Ringelberger Revier war 9,929 qkm groß). Unterwegs zumIrlweiher kommt von rechts das Wasser vom Katzenbach dazu. Der derzeitigeGrenzverlauf wurde bereits im Jahre 1548 in einem Vertrag zwischen demHerzogtum Kurpfalz und dem Königreich Böhmen festgelegt und im 18., 19.,und 20. Jh bestätigt (also nicht verändert). Zuletzt noch vor etwa einemJahrzehnt. Man fand lange Zeit noch Grenzsteine mit der Bezeichnung KP(Kurpfalz) und KB (Königreich Böhmen). Der Verlauf der Grenze wurde imoben aufgeführten Vertrag wie folgt beschrieben: von dannen auf den Grießbacher Steig, hinführt der auf dasMayerbrünnlein hinter der ödn Parre, von dannen in den Haberbach, vondannen in die Öd reichenbach an das Hartberger nämlich sollenwaldsassischen Begehung die Grenze von Anfang der drei durchaus bis andie Öde und jetzt geraumte Wiesen Reichenbach gegen obgemeldetetachauerische Grenze, welche Anfahrt am Fürtlein, in den Holstein undendet in dem fichtenden Stock bei der Öde Reichenbach nach Gelegenheitder Breite und Weite zerschlagen in Vierteln geteilt, dero drei Kronböheimb an die Herrschaft Tachau stoßend und der vierte Teil des StiftsWaldsassen, gegen Mähring und desselben Untertanen zustehenden undbleiben Zur Herrschaft Tachau gehörte auch das Ringelberger Revier, welches dieGemeinde und Staatsgrenze zu Bayern bildete. Im vorher angeführtenVertrag war die Rede vom Grießbacher Steig, der seinen Anfang imRingelberger Revier nahm. Dieser Steig wurde ehedem nachweislich alsÜbergang in die Kurpfalz (Oberpfalz) benützt. Man durfte bis ungefähr1806 alle am Körper tragenden Güter zollfrei mitführen. Es war ein altesPrivileg , das auf Kaiser Karl der IV. zurückzuführen war. Er hatte jaeine Kurpfälzische Prinzessin zur Ehefrau erkoren und wollte damit seineVerbunden mit dieser Region unterstreichen. Das Revier wurde 1935 von derletzten Besitzerin Gräfin Aglae Apponyi de Nagy auf Palma , Ungarn ( +25.04.1961 in Wien), Tochter des Fürsten Alfred III von Windisch Grätz( +23.11.1925 zu Tachau), an den Pilsener Industriellen Hugo Semmler, US Staatsbürger, verkauft. Steinbach Der Bach entspringt südlich des bayerischen Grenzortes Grießbach undfließt in südlicher Richtung nahe der Staatsgrenze dem Reichenbach zu.Das Gewässer weist auffallend viele Steine auf und dürfte davon den Namenhaben. Auf älteren Karten ist als Zufluß ein Gansbach angegeben.Angenommen wird, daß an diesem Bach die mittelalterliche aufgelasseneOrtschaft Stainbach lag. 1 Reichenwiesen Die etwa 8 ha großen Reichenwiesen liegen meist auf böhmischer Seite,welche ehemals extenstiv bearbeitet wurden. Diese waren u.a. im Besitzvon Josef Häupl (Schöllerer), HsNr. 10 und Karl Bitterer (Konas),HsNr. 79aus Galtenhof. Während der sogenannten Sudetenkrise im Jahre 1938verließen einige bedrängte Bewohner des Grenzgebietes über diese Wiesenihre Heimat, um in Bayern Sicherheit für ihre Person zu erlangen.Meistens waren sie mit Sensen und Rechen ausgestattet, um eine Erntehilfevorzutäuschen. Die Tschechen hatten damals zusätzlich Soldaten zurBewachung der Staatsgrenze eingesetzt, die auch von den SchußwaffenGebrauch machten. Diese Flucht war also nicht ungefährlich. Heute hat derWald große Teile der Wiese in Böhmen zurückgeholt, weil CR auf diewirtschaftliche Nutzung verzichtet Fast mit Sicherheit kann man annehmen, daß es an den Reichenwiesen einstdie Ortschaft Reichenbach gab. Der Ortsname weist darauf hin, daß dieSiedlung am reichen Bach lag (Brunner, Lanzendörfer). In den Wässerndieser Gegend gab es früher auch viele Perlmutter Muscheln, weil dasWasser sehr rein und klar war. Im UrbTach hieß es: estlich des Fahren Bach, der sich anfällt, bey der öde Pach und durch den Waldt fließt.JK: am Reichenbacher Flüßl bis zum Reichenbacher Flüßl. Die Chronikder Stadt Amberg enthält Einträge aus dem 13 und 16. Jh über eineSiedlung Reichenbach, die auf Zehentleistungen des Dorfes beiHermannsreuth hinweisen (Brunner). Auch in der Beschreibung des MähringerForstes (zum Kloster Waldsassen gehörig) um 1614 gab es Hinweise aufdiese Ortschaft. Diese lauteten: an der böhmischen Grenze hinterGriesbach, auf der Reichenbacher Wiesen, da wo es die Küche heißt, gräbtman jetzt noch nach Schätzen, am reichenbacher Rangen, sonstGoldschächtel genannt. Am Reichenbach sieht man noch Erz Waschhalden.Im Verzeichnis der verschwundenen Orte im Bezirksamt Tirschenreuth , S.504 ff, erscheint der Name Reichenbach bei Hermannsreuth (Brunner). DerHeimatforscher Josef Schnabel, Oberlehrer in Galtenhof, hat nach demStandort der ehemaligen Siedlung noch vor dem Anschluß unserer Heimat andas Deutsche Reich geforscht, das vor allem auf bayerischer Seitemißtrauisch beäugt wurde. In der Chronik von Galtenhof, aus der Auszügeerhalten sind, heißt es: Westlich vom Grenzstein Nr. 31 sind dieReichenwiesen uneben und buckelig; kleine Hügel lassen aufdarunterliegenden Mauerschutt schließen. Ein verfallener Graben einigeMeter nördlich, längs des Baches mit einem entsprechenden Gefälle kannmit Sicherheit als Mühlgraben gedeutet werden. Der Standort der Mühle isterkennbar. Auffallend ist ein ringförmiger Wall noch etwas weiternordöstlich. In der Geschichte des Klosters Waldsassen von Johann BaptistBrenner findet sich auf Seite 77 folgender Vermerk: Gunzmann, Bürger ausdachau (Tachau), besaß die ville Reichenbach bei Grießbach, gab sie aufRat Gußmannes, Pfarrer in Peidl, dem Kloster Waldsassen wieder zurück,erhielt sie aber doch wieder aus Gnade zur lebenslänglicher Nutznießung.Auf Seite 275 ist als Grenze des Stiftes Waldsassen die Öde Reichenbachangeführt. Der Chronist meint, daß der Ort im Dreißigjährigen Krieguntergegangen ist; er führt diese bedeutende Tatsache an, die als Beweisgelten soll: Am 15. Juli 1621 plünderten die Truppen Mansfelds Bärnau,Tirschenreuth und Waldsassen. Hierbei dürfte des Dorf Reichenbach mitzerstört worden sein. Der Heimatforscher Dr. Karl Lanzendörfer aus Tachauschreibt: Das Dorf war im Besitz eines Tachauer Bürgers namens Gunzmann,der es in der Form einer Stiftung dem Kloster Waldsassen übereignete.1464 wird das Dorf als Reychenbach erwähnt. 1654 führt die Örtlichkeitden Namen Wise öedt Reichenbach im Behemmer Waldt. Der Ort Reichenbach hat somit tatsächlich bestanden. Daß so wenig übriggeblieben ist, macht auf das Schicksal der Orte Hermannreith,Baderwinkel, Paulusbrunn und Paulushütte im jetzigen Grenzgebietaufmerksam. Auch von diesen Siedlungen ist heute nach nur 50 Jahrennichts mehr zu sehen. 2. Katzenbach (Gemeinde Galtenhof) Der Katzenbach hat 5 Quellen. Der wasserreiche Bachlauf kommt von derLandesgrenze her (Baderwinkel). An diesem Wasser lag der Mühlweiher, dasHegerhaus und die Katzenmühle. Die Quellen entspringen am Katzenberg (715m Sh) und vereinigen sich bei der Mühle , welche zuletzt nicht mehr inBetrieb war. Der Bach fließt letztendlich in nördlicher Richtung weiter,unterläuft die Straße von Paulusbrunn nach Galtenhof und mündet bei denJägerhäusern etwa 400 m nördlich des Edelweihers bei Galtenhof in denReichenbach. SK: Katzenmühl, Inh. Margarete Steinhauser, Nr. 64,Müllerin. GenLk: Katzen M. JGS: Im Walde liegt am Katzenbach dieKatzenmühle. Die Wasserkraftanlage wurde erst im 19. Jh erbaut und inden 1920er Jahren stillgelegt. JK: hat den FlN Katzenloh: Die FamilieSteinhauser wurde im Jahre 1946 vertrieben. Erlweiher Der Teich ist 400 m lang und 120 m breit und der Damm ist bis zu 10 mhoch. ThK: Herrschaftlicher Teich, irrlweyher genannt. SK: Erlweiher,der Teich in der Erlenlohe ist sehr alt; er wurde im DreißigjährigenKrieg zerstört. Um 1645 wurde er wieder bespannt. Am Weiher entstand dasgleichnamige Waldhäuslerdorf, welches seit Anfang des 18. Jh unter denNamen Galtenhof bekannt wurde. Der Teichname wurde wahrscheinlich vomErlengewächs abgeleitet, das in der Nähe in großer Anzahl vorhanden ist.Aus der Irlohe wurde im Jahre 1663 in der Tachauer Pfarrmatrikbeurkundet. 3. Galtenhofer Mühle ThK: Galtenhofer eingängige Mühle. JK: Mühl fom Einem Gang., demMathes Träger zu No 50 gehörig. JGS: die Galtenhöfer und Haselmühl.WaW: Galtenhhöfer und Hassel Mahlmühlen an gleichnamigen Werkteichen.MüV: Galtenhof, Inh. Joh. Zünderer, M. eingängig, oberschlächtig,Gefälle 4 m, Leistung 6 PS. Die Benennung wurde vom Ortsnamenabgeleitet. Die Mühle lieferte ab 1929 auch Licht (Gleichstrom) fürGaltenhof. Der letzte Inhaber Josef Zünderr ist am 17.01.1942 in derUkraine an Fleckfieber verstorben. Die Familie Z. wurde 1946 vertrieben.Die Anlage wurde zerstört 4. Schindelsäge Im 19. Jh war hier ein Glaspolierwerk, später eine herrschaftlicheSchindelsäge tätig. MüV: eingängig, oberschlächtig, Gefälle 4 m,Leistung 5,2 PS. Zuletzt wurden Holzformen hergestellt. Bis zurVertreibung im Jahre 1946 wohnte hier die Familie Frank, HsNr. 66. DasGebäude wurde bis zum Jahre 1997 als Gemeinschaftshaus mitGaststättenbetrieb der Forstverwaltung und dem Uranabbau Betrieb ausTachov (Tachau) genutzt. Das Haus wurde 1997 durch fahrlässigeBrandstiftung erheblich beschädigt; inzwischen wird es aber wieder alsGaststätte genützt. Es ist das einzige Gebäude am Reichenbach, welchesnach 1946 erhalten blieb. 5. Mathildensäge Dort war einst ein Zahnhammer. JK: obrigkeitliche Weiß an der altenMühl. SK. Zahnhammer. WaW: Fürstlicher Hochofen samt zweiStabhämmer, wo im 19. Jh die Tachauer Herrschaft die Eisenverarbeitungversucht hat. In der Hammerschmiede wurde Zaine (dünne Metallstäbe)erzeugt. Nach dem Mißerfolg der Eisenwerke ist diese nach 1870 in eineBrettsäge , welche den Namen von der Fürstin Mathilde von Windisch Grätz erhalten hat, umgebaut worden. Als der Inhaber die TachauerDampfsäge errichtete, wurde die Säge stillgelegt und das Haus zu einerWohnung umgebaut. Später erwarb die Familie Häupel aus Paulusbrunn dasGebäude und betrieb darin eine Holzdrechslerei. Schlacken alsÜberbleibsel vom Hochofen waren auch zuletzt noch zu finden (vor allemauf den daneben liegenden Fußballplatz des FC Galtenhof). Die Familie H.wurde 1946 vertrieben. Die Anlage wurde durch die Grenztruppen zerstört. Haselbach Ein 5,2 km langer Zufluß zum Reichenbach, welcher an den Abhängen desSteinberges (751 m Sh) entspringt und in südlicher Richtung weiterfließt. Das Gebiet nannte man auch zu den drei Flüßen. Durch dieSchwarze Lohe am Kaltenbrunen (JK) läuft das Wasser nahe derSchutzzone für die Brunnen der Tachauer Wasserleitung vorbei. Die Flurheißt Hellohe bzw. Haßlohe (JK). Von rechts mündet dann das sogenannteHussenbächlein das im JK beym Hussenbachl genannt wird. Der Sage nachsoll der frühere Grundherr von Tachau, Husman von Namedy und Ringolei,Rheingau, dort öfters gelagert haben. Die benachbarten nassen Wiesentrugen den Namen Hussenlohe, die nahe Quelle hieß Hußenbrunnen;westlich davon befindet sich der Hussenberg (672 m Sh). Etwas einenhalben km Bach abwärts mündet von links aus der Säufleckflur kommend dasSäufleckgrabenbachl. Dann unterquert der Bach eine Brücke, wo derWaldweg von Ringelberg nach Griesbach (Bayern) verläuft. Dieser Weg wurdefrüher als Grenzweg benutzt. Die umliegende Flur hieß Brucklohe. Unweitdavon, fast an der Staatsgrenze , lag die höchste Anhöhe der GemeindeRingelberg, der Altarstein (707 m Sh). Heute heißt der Berg Oltar undist mit 710 Sh auf den Karten angegeben (die Vermessung erfolgte frühervon der Adria aus, heute dagegen von der Nordsee) .Der Name wurde voneinem großen Steingebiet abgeleitet, welcher die Form eines Altars hat.Die Sage berichtete, daß dort unsere Vorfahren in frühen Zeit eineKultstätte hatten, was aber unwahrscheinlich ist. Das Wasser fließt zumHaselteich weiter. In der Nähe des Teiches befand sich das sogenannteJägerhaus, das Forsthaus des Ringelberger Reviers (Forsthaus am Thörlgenannt). Es war nach 1935 der Sommersitz des US Amerikaners HugoSemmler. Dieser verließ bereits im Frühjahr 1938 die csl Republik undging nach den Staaten zurück. Das Haus wurde später alsMüttergenesungsheim des Reichsgaues Sudetenland genutzt. Ein Verwandterdes Industriellen kam als Besatzungssoldat wieder und machte die Bewohnerunserer näheren Heimat darauf aufmerksam, daß sie alle ausgesiedeltwerden würden. Niemand glaubte dies! Hugo Semmler bekam seinen Besitz nicht mehr zurück, obwohl er US Staatsbürger war. Die Beschlagnahme blieb aufrecht, bis heute. Tachauer Hochdruckwasserleitung Mit dem Bau der Wasserleitung, dessen Quelleneinzugsgebiet imRingelberger Revier liegt, wurde die Firma Bill und Co, Reichenberg /Teplitz Schönau beauftragt, nachdem der Revierinhaber, Fürst Alfred IIIvon Windisch Grätz, auf seine Wasserrechte kostenlos verzichtete. ImJahre 1923 wurde mit dem Bau begonnen und 1924 war die Baumaßnahmeabgeschlossen. 12 Quellen lieferten das vorzügliche Wasser, welches zuturm artigen Schutzhäusern weiter floß. Gesammelt wurde das Wasser imsogenannten Wasserschloß, nachdem es von verschiedenen Filtrieranlagendurch Kies, Sand u.a. gereinigt worden war. Von dort trat es den Weg zurStadt Tachau an. Die Wasserleitung berührte zunächst den OrtsteilJägerhäuser in Ringelberg , wo einige Haushalte direkt angeschlossenwaren, floß an Hals und Stiebenreith vorbei zum Hochbehälter amGalgenberg in Tachau, ehe es an die Tachauer Haushalte abgegeben wurde. HAselteich Der Teich ist 3,97 ha groß; der Inhalt beträgt 30 Tcbm Wasser.Träumerisch und still liegt er mitten im Wald des Ringelberger Reviers,welches heute dem tschechischen Staat gehört. . JK: Haaßlweyher. SK:Teich Hassel. JGS: an dem Haselteiche gelegen. Die Bezeichnungstammt vom durchfließenden Bach. Heute befindet sich der Weiher in einemausgewiesenen Naturschutzgebiet , worin nichts verändert werden darf. DerTeich beginnt langsam zu verlanden, weil auch dort der Wasserspiegelwegen des Trinkwasserstausees bei Sorghof (von dort bekommt heute dieStadt Tachau das Trinkwasser) abgesenkt wurde. Ruhbergweiher Der Teich lag einst im Bereich des Berges Ruhberges (638 m Sh), auchGosterl genannt. Dort führte früher der alte Griesbacher Steigvorbei. Sein Name wies auf eine Ruhestätte hin, wo die Zugtiere wegen desstarken Anstiegs rasten mußten. TachUrb: Griesbacher Ruhstatt. DerWeiher ist nicht mehr aufzufinden, weil dessen Damm um 1875 zerstört wurde (starker Wolkenbruch in unserer Gegend). 6. Haselmühle (spätere Adlerfabrik) (Oberer Ruhberg) JGS: obrigkeitliche Eisenhämmer, ein anderer am Thörl Letzterer konnte nur am Haselbach gelegen sein, der den Ortsteil Thörltangierte. Ein anderer Bach als Antriebskraft war am Thörl nichtvorhanden. Die Haselmühle lag etwas seitlich unter dem Ruhberg (Gosterl)mit der später aufgelassenen Brettsäge. Im eigentlichen Mühlgebäude warzuletzt die Familien Bock (HsNr. 86), im Hause nebenan (HsNr. 50) eineFamilie Roth. MüV: Galtenhof Nr. 53 ?, Inhaber Rudolf Adler, Perlmutter Knopffabrik, 1 Francisturbine, Gefälle 5 m, Leistung 6 PS. Als letzter Hammerschmied in der nahen Umgebung war im 19. Jh ein J. Rothtätig. Am Thörl gab im HsNr.27 ein Anwesen mit dem HausnamenHoamaschmied. Der Hausname deutete bei uns oft auf den einstmalsausgeübten Beruf der Vorfahren hin. Der letzte Namensträger war derAgustin Roth (Hoamaschmiedgustl), der am 30.04.1944 dort verstarb. SeineEhefrau Theresia (Franznvei(t)nresl wurde zwar in Hochofen bei Bruck amHammer (Bezirk Plan bei Marienbad ) geboren, kehrte aber mit ihren Elternim Kindesalter (nach Auflassung des Hochofens in Hochofen bei Bruck a.H.)nach Galtenhof zurück (+ 1939). Nahe Verwandte von ihr waren auchweiterhin in der Eisenindustrie tätig, u.a. ihr Onkel Josef Roth, der alsWalz und Gießermeister in Potschawl bei Prag beschäftigt war. Derletzte Hammerschmied könnte im nachgewiesenen Hochofen (spätereSchindelsäge), der Haselmühle oder am Neu bzw. Ruhberghammer inRingelberg tätig gewesen sein, welche alle im 19. Jh ihre Eisenproduktionaus den bereits vorher erwähnten Gründen einstellen mußte, weil anderenOrts (Josefihütte, Holleischen usw) bereits Kohle als Heizmaterialverwendet wurde. Die in unserer Gegend gewonnene Holzkohle hatte alsBrennstoff für Verhüttungszwecke ausgedient. Gustav Roth war meinGroßvater mütterlichseits. Leider ist durch die Vertreibung dieaufgezeichnete Familiengeschichte verloren gegangen; beim Einmarsch derAmerikaner wurde das Anwesen Nr. 27 mit anderen Gebäuden in Brandgeschossen und wurde wegen der Vertreibung nicht wieder aufgebaut. Adlerfabrik
files
| Title | |
| Description | |
| Id | 58374 |
| Upload date | 2020-03-22 18:29:45.0 |
| Submitter |
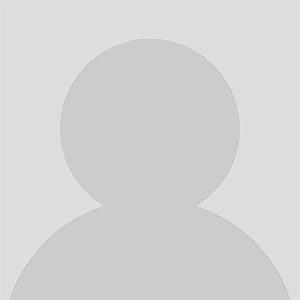 Arne Max Träger
visit the user's profile page
Arne Max Träger
visit the user's profile page
|
| arnetraeger@gmx.de | |
| ??show-persons-in-database_en_US?? | |